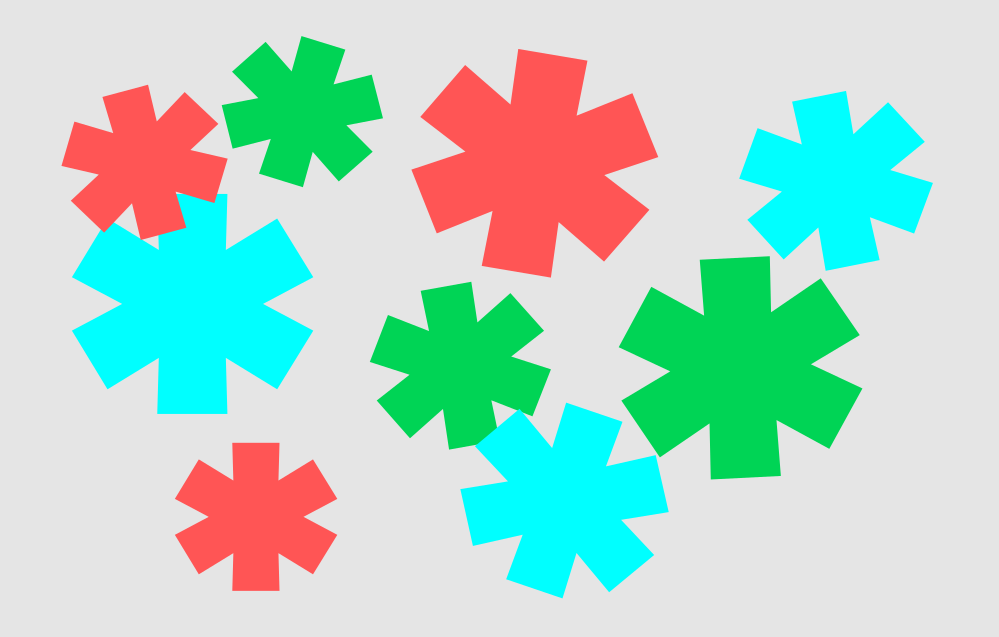„Die Zerstörung der deutschen Sprache“, „Diskriminierung von Männern“, „Genderwahn“. Ganz schön große Begriffe, wenn wir bedenken, dass es eigentlich nur um ein Sternchen oder einen Doppelpunkt geht. Dennoch können wir in den letzten Monaten, vor allem beim Scrollen durch Social Media, das Gefühl bekommen, dass die Debatte um genderneutrale Sprache von Kritiker:innen auf keiner kleineren Flamme gekocht werden kann. Ich frage mich: Geht es nicht eine Spur unaufgeregter?
Vorneweg: Ich bin weiß, cis, hetero und damit in allen Diskriminierungsthemen nicht selbst betroffen. Da ich in dieser Gesellschaft niemals unterdrückt werde, möchte ich mir nicht anmaßen, subjektive Eindrücke zu beschreiben, da es mir selbst an solchen fehlt. Stattdessen soll es vor allem um das gehen, was aus wissenschaftlicher Sicht für das Gendern spricht. Und ich möchte mit der anstrengenden Mär von der Zerstörung der deutschen Sprache ausräumen.

Wenn wir über eine Gruppe von Menschen, fast unabhängig ihrer Größe, sprechen, nutzten wir in der deutschen Sprache in den letzten Jahrzehnten meist das sogenannte generische Maskulinum. Aus einer Gruppe von zehn Wissenschaftlerinnen und fünf Wissenschaftlern wurden also „die Wissenschaftler“. Die Bezeichnung sagt zunächst nichts über das Geschlecht dieser Gruppe aus. Sie bezeichnet eine Gruppe von Menschen, die sich mit der Wissenschaft beschäftigen.
Die Entwicklung des generischen Maskulinums in der deutschen Sprachgeschichte ist kaum erforscht und ziemlich umstritten. In den letzten Jahrzehnten etablierte sich der männliche Plural als allgemeingültiger Begriff für beide Geschlechter. Bereits im Jahr 1748 empfahl allerdings der Schriftsteller Johann Christoph Gottsched in seiner “Grundlegung der deutschen Sprachkunst”: Man solle immer dann Bezeichnungen wie “Oberstinn”, “Hauptmännin” oder “Doctorin” nutzen, wenn Frauen diese Funktion ausüben.
Doch weg von der kleinen Geschichtsstunde. Was ist das Problem des generischen Maskulinums? Zuvorderst die Tatsache, dass unserem Gehirn grammatische Regeln egal sind. Die grammatische Definition des generischen Maskulinums als für alle geltend, kann nicht verändern, dass unsere Vorstellung anders arbeitet. Eine Vielzahl psycholinguistischer Studien hat sich in den letzten Jahren mit dieser Thematik beschäftigt.
Eine Studie der Universität Mannheim stellte zum Beispiel im Jahr 2001 fest, dass Versuchspersonen signifikant mehr Männer nennen, wenn sie nach berühmten Musikern oder Schriftstellern gefragt werden, als wenn beispielsweise nach „Musikerinnen und Schriftstellerinnen“ gefragt wird. Auch Studien, die mit Reaktionszeitmessungen arbeiteten, lieferten handfeste Ergebnisse. Versuchspersonen bekamen dafür verschiedene Satzkombinationen präsentiert, zum Beispiel:
“Die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof.”
“Wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere der Frauen keine Jacke.”
Die Frage war dann: Ist der zweite Satz eine sinnvolle Fortsetzung des ersten - ja oder nein? Gemessen wurde die Zeit, bis die Leute “ja” drückten. Über diese Reaktionszeit versuchen Forschende indirekt herauszufinden, wie gut Sprache und die Bilder, die dabei im Kopf entstehen, zusammenpassen. Das Ergebnis: Die Reaktionszeit war immer dann länger, wenn im zweiten Satz Frauen vorkamen. Dieser Effekt lässt sich nicht nur bei stereotyp männlich besetzten Berufen entdecken. Selbst bei stereotyp weiblich besetzten Berufen, wie Kosmetiker oder Erzieher, denken Leute in Experimenten eher an Männer.
Das Fazit aus diesen Studien ist also eindeutig. Das generische Maskulinum ist zwar nach grammatischen Regeln generisch, in der Lebensrealität allerdings nicht. Es erzeugt vor allem männliche Bilder im Kopf und bildet damit die Gesellschaft nicht so ab, wie sie ist.
Das ist deshalb ein Problem, weil Sprache ein wichtiges Instrument unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ist, und zwar von klein auf. In einer Studie der Freien Universität Berlin aus dem Jahr 2014 wurden knapp 600 Grundschulkindern verschiedene Berufe vorgestellt. Wurden ihnen dabei Berufe in geschlechterneutraler Sprache präsentiert (etwa Ingenieurinnen und Ingenieure oder auch Ingenieur:innen), trauten sich Mädchen viel eher zu, stereotype „Männerberufe“ zu ergreifen. Auch Jungen wählten häufiger stereotype „Frauenberufe“, wenn gegendert wurde.
Dieser Teil der Forschung wird besonders von der rechten Seite des politischen Meinungsspektrums gerne als Argument missbraucht, um eine Umerziehung unserer Kinder herbeizufantasieren. Dabei wird ausgeblendet, dass das Gegenteil der Fall ist. Hier besteht die Chance, Kinder aus gesellschaftlich festgefahrenen Strukturen ausbrechen zu lassen, um ihre eigene Persönlichkeit und ihren eigenen Lebensweg zu entdecken. Selbstfindung ist das Gegenteil von Umerziehung.
Gender Studies sind inzwischen, glücklicherweise, immer breiter aufgestellt. An der Stelle lasse ich es aber auf den Studien beruhen, die ich bereits genannt habe. Sie sollten genug Einblick gebracht haben, warum eine genderneutrale Sprache ihre Vorzüge hat. Stattdessen möchte ich noch ein bisschen was zur deutschen Sprache und Sprache an sich loswerden.
Sprache ist grundsätzlich und ganz einfach gehalten ein Mittel, mit dem wir kommunizieren. Sie ist damit ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Nicht umsonst ist der Sprachunterricht einer der Kernaspekte der Integration von Menschen in ein neues Land. Die Sprache beeinflusst und verbindet jedoch nicht nur die Gesellschaft, sondern steht mit dieser in einer laufenden wechselseitigen Beziehung. Ändern sich gesellschaftliche Verhältnisse, ändert sich oft auch die Sprache. Allein im Jahr 2020 sind 3.000 neue Wörter in den Duden aufgenommen worden, 300 Begriffe sind dafür rausgeflogen.
„Die deutsche Sprache“ gibt es letztlich nicht. Korrekter wäre es, Deutsch als die Sprache zu definieren, die in Deutschland aktuell gesprochen wird. Während es feste Grundregeln gibt, hat sich die Feinjustierung über die Jahrhunderte bereits hundertfach verändert. Wie oben aufgeführt, haben sich bereits im 18. Jahrhundert Schriftsteller Gedanken über eine genderneutrale Sprache gemacht, auch wenn sie das Wort Gender damals vermutlich nicht mal kannten.
Es ist an uns allen zu entscheiden, wie wir die Sprache weiter entwickeln wollen. Entwickeln wird sie sich nämlich sowieso. Hierbei können wir, um zum Hauptthema zurückzukommen, entscheiden, ob wir uns weiter entwickeln wollen oder auf der Stelle treten, nur weil wir das schon immer so gemacht haben. Denn um die großartigen Wissenschaftler:innen von Quarks zu zitieren: „Letztlich kann die Wissenschaft zwar die Effekte von Sprache untersuchen und daraus Empfehlungen ableiten. Was sich im Sprachgebrauch durchsetzen wird, entscheiden am Ende allerdings wir selbst.“
Ich persönlich habe mich entschieden. Für eine Sprache, die alle Gesellschaftsmitglieder anspricht, egal welcher Sexualität sie angehören. Für ein Miteinander denken, statt ein Gegeneinander denken. Und vor allem für ein einfaches Mittel, um viel zu lange festgefahrene Strukturen ein Stück weit aufzubrechen. Denn natürlich ist klar, dass eine flächendeckend gendergerechte Sprache nicht automatisch für mehr Gleichberechtigung sorgt. Wir müssen nach wie vor auf Diskriminierung von Transpersonen aufmerksam machen, nach wie vor gegen den Gender Pay Gap und für die Frauenquote kämpfen, nach wie vor dafür sorgen, dass alle Teile der Gesellschaft als gleichwertige Teile behandelt werden.
Gendern ist ein erster kleiner Schritt. Ich freue mich über jede:n, der ihn mitgeht.
Patrick Röttele